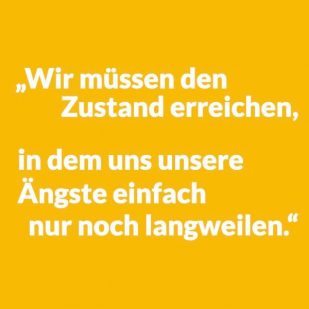An diesem nächsten Salon-Abend sind Anselm Bilgri und Dr. Nikolaus Birkl im Gespräch mit dem Gastronom Wiggerl Hagn.
Wiesnwirt seit über 40 Jahren, Gastronom in der Hirschau im Englischen Garten, lange Zeit Präsident des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, ein Wirt wie er im Buche steht. Wiggerl Hagn ist ein Münchner Original und dabei ein Mensch, der Gelassenheit und Ruhe ausstrahlt, das, was man in München Gemütlichkeit nennt. Vielleicht kann er sein Rezept für eine gelassene Lebensführung verraten. Darüber wollen Dr. Nikolaus Birkl und Anselm Bilgri mit ihm sprechen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind. Bitte melden Sie sich hier zur Veranstaltung vor Ort oder zum Livestream an: Anmeldung.
Weitere Programminformationen finden Sie unter www.cafe-luitpold.de/salon-luitpold-kultur-unter-palmen.html